
Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat hat schon 2019 die interessante und lesenswerte Broschüre ›Neue Partner für die Quartiersentwicklung‹ herausgegeben, in der für eine erweiterte Zusammenarbeit beim „Stadt-Gestalten“ zwischen staatlichen Strukturen und gemeinwohlorientierten zivilgesellschaftlichen Initiativen argumentiert wird.
In der Broschüre werden grundlegende Vorteile des Ansatzes der kooperativen Stadtentwicklung dargelegt, welcher auch von den Akteuren der ›Baustelle Gemeinwohl Plattform‹ verfolgt wird. Daher weisen wir auch 2023 gerne noch auf die Broschüre hin und möchten besondere Aufmerksamkeit auf den Teil mit den Empfehlungen lenken, den wir hier (siehe unten) abbilden.
Die ›Empfehlungen‹ aus der Broschüre
WARUM SOLLTEN INITIATIVEN UNTERSTÜTZT WERDEN?
Gemeinwohlorientierte Initiativen in der Stadt- und Quartiersentwicklung genießen in der letzten Zeit mehr Aufmerksamkeit. Sie treffen mit ihrem Engagement einen gesellschaftlichen „Nerv“. Sie bewegen sich häufig abseits des Mainstreams und mobilisieren Engagement für Projekte und Themen, die in den normalen Routinen des gesellschaftlichen Handelns manchmal abseits liegen bleiben. Damit lenken sie auch Ressourcen und wirtschaftliche Aktivitäten in ansonsten vernachlässigte Bereiche. Die skizzierten Steckbriefe in dieser Broschüre veranschaulichen das.
Worin die von derartigen Initiativen ausgehende Faszination genau besteht, ist schwer zu sagen. Einmal scheint es der Umstand zu sein, dass sich Menschen nicht nur für das individuelle Wohl, sondern für Gemeinschaftsprojekte engagieren. Daneben sind es wohl auch die häufig außergewöhnlichen, innovativen Projekte. Sie symbolisieren, „dass es auch anders geht“ oder zumindest gehen könnte. Insofern stehen sie für eine im gesellschaftlichen Alltag bisweilen vermisste Zukunftsoffenheit und einen daraus entstehenden Lösungsoptimismus.
Eine nüchterne Analyse kommt natürlich auch hier zu dem Ergebnis, dass „gut gemeint“ nicht immer „gut gemacht“ ist. Nicht jedes Engagement trägt, nicht jeder Plan geht auf. Manche Projekte bleiben klein und unscheinbar, andere hingegen entfalten eine hohe Dynamik und bewirken eine Menge und nur wenige scheitern wirklich, wenn sie über einen bestimmten Reifegrad hinaus sind. Dass auch bei gemeinwohlorientierten Initiativen der Erfolg nicht vorprogrammiert ist, sollte eigentlich selbstverständlich sein. Innovation gibt es nicht ohne Risiko, sie verläuft zudem selten geradlinig und ohne Rückschläge. Die Initiativen sind es, aufgrund der in ihnen liegenden Potenziale, wert, öffentliche bzw. kommunale Unterstützung und Wertschätzung zu erfahren. Von welchen Grundgedanken und Einsichten eine solche Unterstützung getragen sein sollte, wird im Folgenden behandelt.
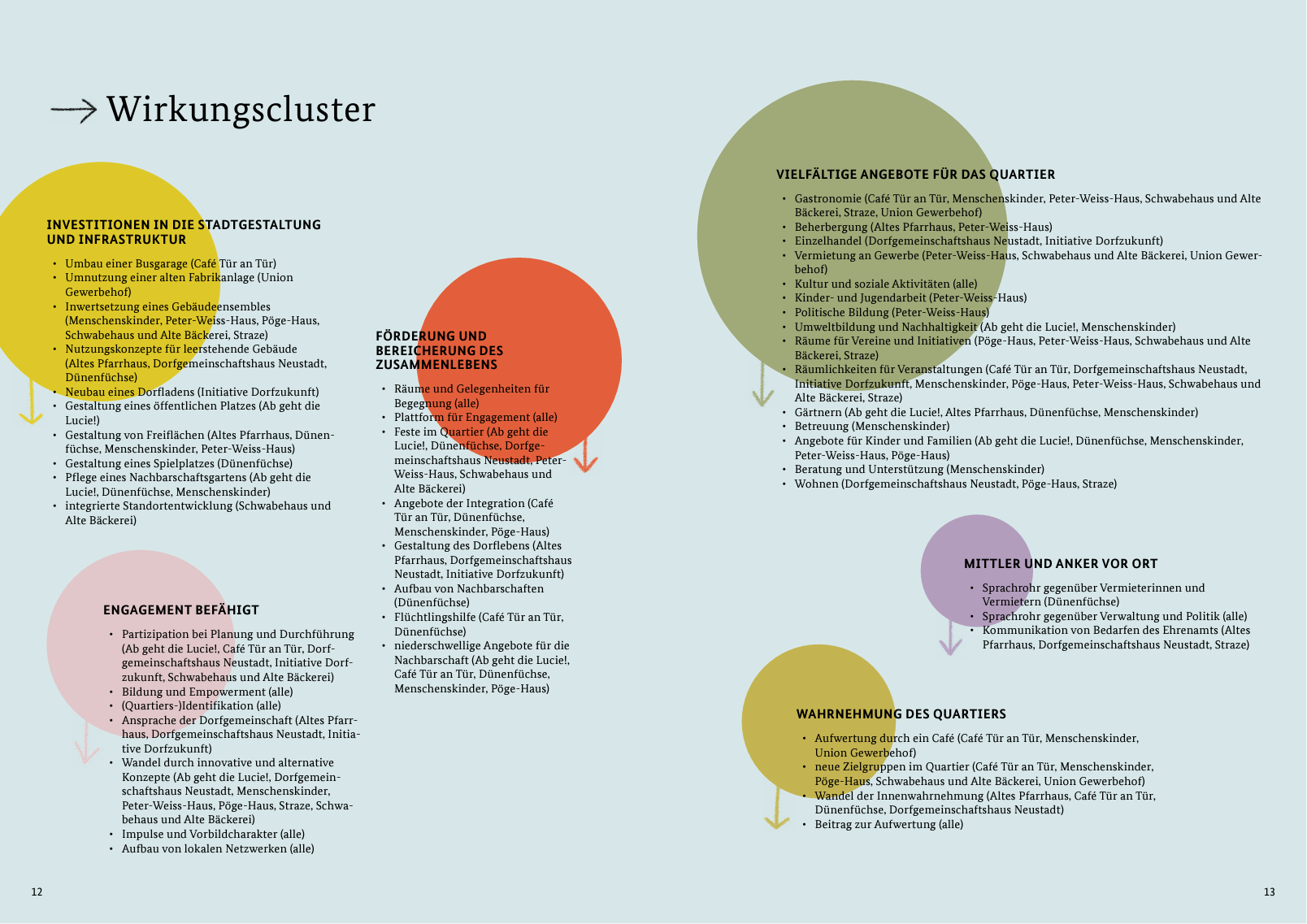
PARTNERSCHAFTLICHEN UMGANG GEWÄHRLEISTEN
Die Initiativen nehmen unterschiedliche Aufgaben wahr, die zu vielfältigen Schnittstellen mit der Kommunalverwaltung und anderen Behörden führen können. Als Immobilienentwickelnde und Investierende sind sie in Planungsprozesse eingebunden, stellen Bauanträge, diskutieren Denkmalschutzauflagen, beantragen Fördermittel oder bewerben sich um kommunale Grundstücke. Als Betreiber der Immobilie und Träger unterschiedlicher Angebote benötigen sie beispielsweise ordnungs- oder gewerberechtliche Genehmigungen. Sie stellen Anträge auf Kultur- oder Sportförderung oder müssen sich als Träger ihrer Angebote (zum Beispiel der Jugendhilfe) anerkennen lassen, um Zugang zu einer passenden Finanzierung zu haben. Viele Initiativen erheben aus ihrem spezifischen Engagement zudem einen Anspruch auf politische Mitgestaltung in der Stadt- und Quartiersentwicklung.
Die zentrale Aufgabe der Kommunen ist es hier, einen partnerschaftlich-wertschätzenden und zugleich unkomplizierten Umgang zu gewährleisten. Denn die Initiativen sind gerade in der Anfangsphase darauf angewiesen, durch schnelle Erfolge, unkomplizierte und manchmal provisorische Lösungen voranzukommen, damit sie das eigene Engagement beflügeln können. Bislang gibt es nicht viele solcher Initiativen. Für deren Betreuung sind keine weiterreichenden Organisationsänderungen oder neue Zuständigkeiten erforderlich. In vielen Kommunen dürfte es stattdessen reichen,
- eine(n) Mitarbeiter(in) mit einer gewissen „mentalen Nähe“ zu den Initiativen erkennbar als Ansprechpartner(in) in der Verwaltung vorzusehen,
- diesem/dieser Mitarbeiter(in) mit einer anwaltlichen „Lotsenfunktion“ ins Aufgabenbuch zu schreiben, so wie dies, zum Beispiel in der Wirtschaftsförderung, weit verbreitet ist
- und schließlich für diese anwaltliche Lotsen funktion eine Rückendeckung aus der und einen Zugang in die Verwaltungsspitze auszustatten, damit im Verhältnis zu anderen Ämtern etwas im Sinne der Initiativen bewirkt werden kann.
FACHLICHE UNTERSTÜTZUNG MOBILISIEREN UND NETZWERKE PFLEGEN
Die in den Initiativen organisierten Personen bringen ganz selbstverständlich ihre beruflich oder auf anderem Wege erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten in ihre Projekte ein. Und innerhalb der Initiativen ist es normal, dass sich entlang der unterschiedlichen Qualifikationen Arbeitsgruppen bilden und eine Arbeitsteilung verabredet wird. Der normale Weg der Initiativen ist das etwas fehleranfällige, aber lernintensive Learning-by-doing, verbunden mit gegenseitiger Unterstützung in Netzwerken. Zahlreiche solcher Netzwerke gibt es bereits. Sie sind in ihrer Reichweite breit gefächert. Oft sind diese Netzwerke überregional oder gar bundesweit organisiert. Mehrheitlich geht es in diesen Netzwerken um die Vermittlung grundlegender Kenntnisse und Vorgehensweisen (wie zum Beispiel die Unterschiede und die Eignung der unterschiedlichen Rechtsformen). Das Bemühen, sich hier möglichst konkrete gegenseitige Hilfe anzubieten, ist klar erkennbar. Wenn es aber um die konkrete Ausgestaltung von Verträgen, um Finanzierungsanträge, Businesspläne oder um besonders diffizile fachliche Fragen geht, können auch diese Netzwerke an ihre Grenzen kommen.
An dieser Stelle könnte und sollte ein aus dem regionalen oder lokalen Kontext heraus agierendes Unterstützungsnetzwerk ansetzen.
- Idealerweise sollte sich eine Kommune darum bemühen, bestehende fachliche (Regionalgruppen unterschiedlicher Berufsverbände) oder zivilgesellschaftliche Netzwerke (zum Beispiel Bürgerstiftungen, Service-Clubs) für diese Themen zu sensibilisieren und auf diesem Wege zum Beispiel Probono-Leistungen zu vermitteln. Derartige regionale Netzwerke würden auch dazu beitragen, dass die Initiativen sich noch besser und mit größerer sozialer Reichweite in der Region verankern und hier auch eine spezifische Rückkopplung zu ihren Ideen und Vorhaben erhalten.
- Ein bei der Kommune verankertes Verfügungsbudget könnte darüber hinaus dazu dienen, ergänzende, kleinteilige Beratungsleistungen zu finanzieren (siehe auch „Förderung konzeptionell anpassen“).
FÖRDERUNG KONZEPTIONELL ANPASSEN
Selbstverständlich gehört es auch zu den Grundaufgaben einer Initiative, solide zu wirtschaften und auch für Unvorhergesehenes Vorsorge zu betreiben. Dennoch bleibt dies bei gemeinwohlorientierten Geschäftsmodellen immer eine zum Teil existenzbedrohende Gratwanderung. Um unvorhergesehene Belastungen abzufedern, können „kleine“ adhoc- Zuschüsse oder Überbrückungskredite helfen. Vor Ort wäre jeweils zu prüfen, auf welchem Wege derartige Hilfestellungen zu mobilisieren sind:
- Ein kommunales Verfügungsbudget könnte bereitgestellt werden, das ähnlich wie die aus der Städtebauförderung bekannten Verfügungsfonds funktioniert und bewirtschaftet wird. In Fördergebieten kann ein existierender Verfügungsfonds gegebenenfalls auch für derartige Aufgaben herangezogen werden. In größeren Städten wäre zu prüfen, ob ein gesamtstädtisches Verfügungsbudget für solche Zwecke eingerichtet werden kann.
- Alternativ zu einem kommunalen Unterstützungsangebot ist jeweils vor Ort zu klären, ob bestehende zivilgesellschaftliche Strukturen und Netzwerke für derartige Aufgaben aktiviert werden können (Bürgerstiftungen, CSR-Engagements von Unternehmen etc.).
Häufig zeigt sich bei den Initiativen auch eine Zurückhaltung gegenüber den vorhandenen Förderangeboten. Dies hat mehrere Facetten und wird auf Seite 33 ff. näher beschrieben. All dies gilt insbesondere für junge Initiativen, die ideell und konzeptionell noch nicht gefestigt sind und von daher größeren Wert auf ihre Unabhängigkeit legen (müssen). Insofern ist es auch in diesem Kontext wichtig, die Förderangebote als Bestandteil einer insgesamt partnerschaftlichen Zusammenarbeit zu etablieren.
ZUGANG ZU IMMOBILIEN VERBESSERN
Überwiegend haben die porträtierten Initiativen eine Altimmobilie wieder in Nutzung gebracht und sie zuvor entsprechend saniert bzw. hergerichtet. Banken, die sich auf derartige Vorhaben und den damit verbundenen Herausforderungen spezialisiert haben, treten als Finanzierungspartner auf. Darüber ergeben sich für die Kommunen die folgenden Ansatzpunkte:
- Die regionalen Banken sollten für die Themen der Quartiersentwicklung und die Besonderheiten der Initiativen sensibilisiert werden. Gegebenenfalls kann die Kreditvergabe durch kommunale Bürgschaften abgesichert werden.
- Die in Frage kommenden Grundstücke und Immobilien sollten für ein ausreichend großes Zeitfenster reserviert werden (Anhandgabe für mindestens ein Jahr), damit die Initiativen genügend Zeit zur Klärung aller konzeptionellen, juristischen und nicht zuletzt wirtschaftlichen Belange haben. Private Grundstückseigentümer sollten von den Kommunen dahingehend informiert und sensibilisiert werden. Bei nicht interessierten privaten Grundstückseigentümern sollte ein kommunaler Zwischenerwerb geprüft werden.
- Bei kommunalen Grundstücken sollten Konzeptvergaben angewandt werden, um die besonderen Potenziale der Initiativen bewerten und in einen günstigen Kaufpreis übersetzen zu können. Eine besondere Rolle kann auch die Vergabe von Erbbaurechten spielen, da sie in ähnlicher Weise wie ein günstiger Kaufpreis die Finanzierungslasten senken und damit auch den Projektstart erleichtern können.
- Sofern der Zugang zu Städtebaufördermitteln besteht, können und sollten diese sowohl für den Erwerb, für die Grundstücksaufbereitung als auch für die Herrichtung genutzt werden. Dies reduziert die kommunale Belastung und eröffnet Spielräume für eine preisgünstige Weitergabe an die Initiative.
Klassische Förderangebote und hier insbesondere die Städtebauförderung eigenen sich zur Unterstützung von gemeinwohlorientierten Initiativen – gerade dann, wenn sie Immobilien entwickeln wollen. Dies beweist unter anderem der Handlungsansatz „Initiative ergreifen –BürgermachenStadt“desLandes Nordrhein-Westfalen. Mit der Förderung gehen aber auch die Übernahme von öffentlichen Prozessen (Ausschreibung) und Verpflichtungen (Zweckbindung) einher. Ob diese Rollenverschiebung jeder Initiative zuträglich ist, kann nur vor Ort entschieden werden.
